
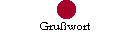


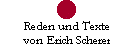
|
Virtuelles Erich Scherer Archiv
Leben in Würde
Natürlich paßt nur ein kleiner Teil dessen, was ein langes Leben,
ausmacht, in eine gebundene Schrift – zumal wenn es so ausgefüllt und
erfüllt war wie das unseres Vaters. Die folgenden Seiten mit Reden,
Aufstellungen, Beschreibungen und einem Teil jener kurzen Blätter, in
denen er Einsichten und Resultate seines Nachdenkens über seine Arbeit
und sein Leben festhielt oder ihm wichtige Gedanken und Sätze aus
Büchern, Reden oder Artikeln notierte; sie sind gedacht als Erinnerung
an den Verstorbenen, als Erinnerung für die Familie und seine Freunde.
Die Idee zu einem solchen Buch ist nicht neu. Nach seiner
Pensionierung haben wir unseren Vater zu bewegen versucht, seine
Erfahrungen aufzuschreiben, ihre wesentlichen Linien zu benennen und
gleichsam die Summe aus den langen Jahren der Arbeit als Bürgermeister
zu ziehen. Denn es gab ja nicht viele, die wie er in der Lage gewesen
wären, Rückblick zu halten auf fast vier Jahrzehnte
Nachkriegsentwicklung, und es wäre bei dieser Erinnerung ja nicht nur
um das Dorf Frickenhausen und später noch um Tischardt und Linsenhofen
gegangen, sondern auch um die Geschichte der Region und des Landes. Er
wollte nicht und hat den Vorschlag abgelehnt, aus der Angst heraus, sich
selbst für zu wichtig zu halten und dem Schein mehr Recht einzuräumen
als dem Sein. Und wenn er nicht wollte, dann wollte er nicht.
So haben nun wir, seine Kinder, die Aufgabe übernommen, nach seinem
Tode aus dem, was er an Schriftlichem hinterlassen hat, ein Büchlein
zusammenzustellen. Es ist für uns ein Teil der Erinnerung und des
Nachdenkens über unseren Vater, darüber, was in den fast 75 Jahren
seines Lebens geschehen, und welche Motive ihn bewegt haben, was die
Grundlage seines Handelns gewesen ist. Und wir wollen diese Erinnerung
und dieses Nachdenken mit anderen, die mit ihm gelebt und gearbeitet
haben, auf dem Wege dieses Buch teilen.
Wir haben auch eine Zusammenstellung dessen, was in der Gemeinde
Frickenhausen und in den Ortsteilen Tischardt und Linsenhofen in seiner
Amtszeit gebaut und entwickelt worden ist, aufgenommen. Es ist nicht
mehr als eine kurze Aufzählung der praktischen Schritte, die von einer
halbbäuerlichen Landgemeinde, deren Bewohner von der Landwirtschaft
nicht mehr so recht leben konnten und deren wirtschaftliche Grundlage im
Schusterhandwerk und in der Textilindustrie zu schmal war, hin zu einer
Industriegemeinde mit in den verschiedensten Branchen tätigen
Unternehmen und mehr Arbeitsplätzen, als für die Einwohner benötigt,
führten. Auf einem der kurzen Blätter, das der Handschrift nach zu
urteilen noch aus den 50er Jahren stammen muß, hatte er geschrieben:
,,Man wird uns (d.h. die Bürgermeister) nicht an unseren Absichten
messen, sondern an unseren Erfolgen.” Und aus dem Umfeld geht hervor,
daß er dabei an den biblischen Satz dachte: An ihren Früchten sollt
ihr sie erkennen. Wir können hier nicht die Einzelheiten der Geschichte
alles dessen aufschreiben, was von 1948 bis 1986 geplant, gebaut und
errichtet wurde. Das muß einer Chronik der Gemeinde Frickenhausen mit
ihren Ortsteilen überlassen bleiben. Aber natürlich war das ,Bauen‘,
die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen, Wasser, Sportstätten,
Schulen, Kindergärten usw. das zentrale Arbeitsfeld des
Bürgermeisters. Allerdings nicht im Sinne einer äußerlichen
Erfolgsgeschichte, die sich selbst genügt. Die Überwindung der Not der
ersten Nachkriegsjahre sollte für unseren Vater nicht in eine
,,Wohlstandsgesellschaft” führen, gar in ein luxurierendes Wohlleben,
sondern in ein ,,Leben in Würde”. Immer wieder hat er erzählt, wie
das Schicksal der Flüchtlinge, die dichtgedrängt in Garagen, Baracken
und einzelnen Zimmern mehr hausten als wohnten, ihn getroffen hat, wie
ihn die Demütigung und der Verlust an menschlicher Würde, den das
Elend diesen Menschen zufügte, erschreckte und bedrückte. Das Problem
war für ihn nicht bloß, daß soundsoviele Wohnungen fehlten, sondern
der Bau von Wohnungen war für ihn zugleich das Mittel, ein Umfeld zu
schaffen, in dem die Menschen ihre Würde wiedergewinnen konnten. Er
selbst mußte nur einfalls- und erfindungsreich genug sein, in
eigentlich unmöglichen Umständen – die Gemeinde war so verarmt wie
die meisten ihrer Einwohner – den Bau von Wohnungen zu ermöglichen.
Zu den glücklichsten Erfahrungen gehörte für ihn sicherlich, daß die
Menschen das, was er versuchte, annahmen, daß sie wieder Mut faßten,
neues Selbstvertrauen schöpften und dann ihrerseits zur Verbesserung
der Lage in der Gemeinde beitrugen. So sehr es richtig ist, daß er in
diesen ersten Jahren als Bürgermeister die Grundlagen für die
Entwicklung der Gemeinde gelegt hat, so sehr haben diese Jahre auch ihn
selbst geprägt.
In dieser frühen Geschichte vom Bau von Wohnungen kommt ein Grundzug
seines Handelns und Denkens zum Vorschein. Er hat oft den ersten
Bundespräsidenten Theodor Heuss zitiert, der gesagt hatte, die Aufgabe
sei nicht, den Menschen zu verstaatlichen, sondern den Staat zu
vermenschlichen. Er selbst zog für sich daraus die Maxime: ,,Die
Gemeinde ist wichtiger als der Staat. Und wichtiger als die Gemeinde ist
der Einzelne.” Das ist ein eindeutiges Unterordnungsverhältnis: der
Staat ist dazu da, die Gemeinde in die Lage zu versetzen, den Rahmen zu
schaffen, in dem der Einzelne, die Familien, die Vereine, das
Gemeinwesen leben kann. Es geht nicht um die Ehre des Staates oder um
die (Selbst-)Zufriedenheit der Verwaltung. Staat und Verwaltung haben
nur die Aufgabe, den Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich das
eigentlich Wichtige, das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Würde
entfalten kann. Wir haben uns als Kinder und Jugendliche oft gewundert,
wie man sich für eine so trockene Sache wie die Verwaltung so
leidenschaftlich begeistern kann, wie unser Vater es tat. Die Erklärung
ist: Für ihn hatte die Verwaltung die Aufgabe, die Grundlagen für ein
menschenwürdiges Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Sie
konnte das Leben in den Familien, den Vereinen, im Dorf nicht ersetzen
oder gar bestimmen, aber sie konnte nach seiner Überzeugung die
Voraussetzungen schaffen, damit dieses Leben entstehen und sich
entwickeln kann. Im Ziel, die kommunalen Voraussetzungen für ein
menschenwürdiges Leben zu schaffen, und in der Beschränkung, dem
Respekt vor dem Leben des Einzelnen, lag beides, die Überzeugungskraft
und die Bescheidenheit, die ihn kennzeichneten.
Darin ist vieles enthalten, auch wesentliche Erfahrungen seiner
Herkunft. Als ältester Sohn kleiner Bauern unmittelbar nach dem 1.
Weltkrieg geboren, gehörten die Notzeiten, der Wechsel von
Geldknappheit und Inflationsverlusten in der Weimarer Republik zu den
wichtigen Erfahrungen der Kindheit und frühen Jugend. Die Eltern hatten
neu gebaut, und die Rückzahlung des Kredits drückte auf die Familie.
Das Realgymnasium in Tübingen konnte er nur besuchen, wenn sein
Notendurchschnitt alljährlich besser war, als was gefordert wurde, und
damit die Zahlung des Schulgeldes, das seine Eltern nicht hätten
aufbringen können, entfiel. Der Vater übte, um die Einkommenssituation
der Familie zu verbessern und wohl auch aus Neigung, das Amt des
Gemeindepflegers während langer Jahre aus. Doch trotz dieser eher
schwierigen materiellen Situation, gehört zu den ersten Erfahrungen
auch die Würde dessen, der zwar arm und bescheiden, aber auf eigenen
Füßen steht, niemandem verpflichtet außer der Moral und den eigenen
Einsichten, und der aus dieser Freiheit – und sei sie mit noch so
vielen Entbehrungen erkauft – seine Selbstachtung zieht. Stark
geprägt worden ist die Moral und die Grundlage dieser Lebenshaltung vom
pietistischen Erbe seiner Mutter, das sicherlich streng war, wohl aber
auch verhindert hat, daß er nach dem Abschluß der Schule als nun
16-Jähriger dem Vorschlag eines NSDAP-Parteigremiums entsprechend auf
eine Eliteschule der Nazis geschickt wurde. Aus der bäuerlichen und
eher ärmlichen Herkunft, die er Zeit seines Lebens nie verleugnete, auf
deren selbstbewußte Identität er im Gegenteil immer stolz gewesen ist,
stammen auch noch zwei andere Charakterzüge: der Blick für die
konkreten Probleme (und daraus folgend die Abneigung gegen bloßes Reden
und Politisieren), und die Einsicht, daß man mit der Natur pfleglich
umgehen muß, will man einen Ertrag von ihr erwarten. Auf die Schule
folgte der Beginn einer Lehre als Verwaltungsbeamter, dann die
Einziehung zum ,,Arbeitsdienst” und schließlich der Krieg.
Unser Vater verstand sich zweifellos als Patriot, und der Kampf fürs
Vaterland war für ihn eine selbstverständliche Pflicht. Dennoch
verdichteten sich für ihn in den letzten Jahren des Krieges die
Zweifel. Es waren die in der Haltung seiner Eltern bereits angelegten
Zweifel an einem übermächtigen Staat. Der faschistische Staat hatte
sich zwar großartig aufgebläht, aber herausgekommen war nur Gewalt und
Leid. Unser Vater wurde vom Hauptfeldwebel zum Obergefreiten degradiert,
Anfang 1943, weil er in einer Diskussion unter Soldaten seine Zweifel in
die Worte gefaßt hatte, daß der ,,Führer der Deutschen Arbeitsfront”
Ley der größte Säufer und der ,,Reichsführer-SS” Himmler der
Untergang des Vaterlandes sei. Er wurde ,,verpfiffen”, und wäre ihm
der Hauptmann der Kompanie nicht wohlgesonnen gewesen, es hätte der
öffentlich geäußerte Zweifel leicht in einer Strafkompanie enden
können. Auch für ihn war Stalingrad ein Wendepunkt; in zweifacher
Hinsicht: zum einen bedeutete Stalingrad die Wende zu einer Niederlage,
wie er einmal formulierte, in einem Krieg, der wohl auch nicht gewonnen
werden durfte. Und zum anderen vergrößerte die Kaltblütigkeit, mit
der aus Propaganda-Gründen fast eine halbe Million Soldaten in
Stalingrad geopfert wurden, die Distanz zum NS-Regime. Konnte er zuvor
noch den Krieg als Kampf für das Vaterland verstehen und darum auch
Opfer für vertretbar halten, so war ihm danach klar, daß es sinnlos
und unverantwortlich war, weitere Opfer zu bringen. Schwer getroffen hat
ihn der Tod seines Bruders Richard, der kurz vor Weihnachten 1942 an der
Ostfront zu Tode kam. (Er hat dann seinen ersten Sohn nach ihm benannt.)
Er hob immer wieder die Kameradschaft unter den Soldaten während des
Krieges hervor; das war ihm das Wichtigste gewesen. Aber auch das Leid,
das der Krieg hervorbrachte und an dem er beteiligt war, hat ihn sein
Leben lang beschäftigt. Er erzählte uns mehrmals, wie sie nach einem
– militärisch gesehen: erfolgreichen – Bombenangriff, er war bei
den Fliegern, weinend im Flugzeug saßen, weil sie sich nur zu genau
vorstellen konnten, wie die Bomben dort gewirkt hatten, wo sie
einschlugen.
Im Herbst 1945 kehrte er 26-jährig aus Krieg und
Kriegsgefangenschaft bei der englischen Armee in seine Heimat zurück.
Die Zweifel des Krieges löste er, indem er zwischen Hitler-Staat und
Vaterland unterschied; indem er auch das deutsche Volk als Opfer der
Diktatur und des Krieges sah. Und er fand zu dem Grundsatz, daß das
Leben des Einzelnen, der Familie und der Gemeinde wichtiger sei als das
Ehrbedürfnis und das Machtstreben des Staates. Oder anders
ausgedrückt: Daß das Leben und die aus der Selbstverantwortung des
Einzelnen entspringende Freiheit wichtiger seien als die staatlichen
Ansprüche. Die Vorstellung, es könnte eine Gruppe, sei es eine Partei,
die Unternehmer, Banken, die Gewerkschaften oder der Staat selbst so
mächtig werden, daß sie in der Lage wäre, die Menschen zur bloßen
Masse zu machen, war ihm seitdem eine Schreckensvorstellung. Was er
erstrebte war das Gleichgewicht, das allen gerecht wird.
Von der Grundlage dieser Orientierung aus wollte er seinen Beitrag
zum Wiederaufbau und zur Behebung der Nachkriegsnot leisten; und dazu
beendete er zuerst seine Ausbildung als Verwaltungsbeamter und ging für
einige Zeit an die Landratsämter in Rottweil und Tübingen.
Als das Schlüsselerlebnis bei der Kandidatur zum Bürgermeister von
Frickenhausen hat unser Vater mehrmals den Besuch in den
Flüchtlingsunterkünften bezeichnet, zu denen die
Bürgermeisterkandidaten geführt wurden, bevor sie sich den
Bürgerinnen und Bürgern vorstellten. Bei diesem Gang ist wohl seine
innere Entscheidung für Frickenhausen gefallen, und seine
Bewerbungsrede muß dies auch ausgestrahlt haben, sonst wäre das
Wahlergebnis von 92 % nicht zu erklären. Denn die Bewerbungsrede
enthielt ja den Satz, daß er eine rasche Lösung der Probleme nicht
versprechen könne. Die Mehrheit hat sich für ihn nicht wegen
irgendwelcher Versprechungen entschieden. Aber die Bewerbungsrede
enthielt auch die Zusage einer dauerhaften und ernsthaften Arbeit an der
Not auf der Grundlage des Gemeinsinns der Bürger. Und offensichtlich
hat man ihm diesen Ernst geglaubt.
Der Anfang geschah mit dem Bau von Wohnungen, der Wasserversorgung,
der Ausbesserung der Straßen. Aber noch ins ersten Jahr fällt auch die
Wiedereinführung des Kinderfestes, liegen intensive Gespräche zur
Unterstützung der Vereine, gab es erste Überlegungen zu einem
Jugendhaus, um den Vereinen und damit dem sozialen Leben im Dorf einen
Platz zu geben. Und es fanden die ersten Gespräche mit Firmen zur
Industrieansiedlung statt. Man kann darin die drei Äste seiner Arbeit
über all die Jahre (und jeder vernünftigen Kommunalpolitik) erkennen:
Die Sicherung der Grundversorgung mit Wohnungen, Wasser, Straßen und
anderen kommunalen Einrichtungen; die Gewerbeansiedlung als der
wirtschaftlichen Grundlage; und die Schaffung von Räumen, in denen das
soziale und kulturelle Leben des Dorfes sich entfalten kann. Eingebunden
waren diese drei Äste seiner Arbeit in eine langfristige und
grundsätzliche Überlegung, nämlich die zur Region Mittlerer
Neckarraum. Heutzutage ist der Begriff Mittlerer Neckarraum jedermann
geläufig, aber um das Jahr 1950 war die Region ein schattenhaftes
Gebilde, deren Anfänge erst schemenhaft zu erkennen waren. Die
langfristige Überlegung war die: Frickenhausen braucht die Beziehungen
zur Region mittlerer Neckarraum, um sich zu entwickeln. Und zugleich
werden durch das Gewicht der Region Kräfte entstehen, die die
Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der Gemeinde bedrohen und
in Frage stellen. Es ging ihm also darum, die Beziehungen zur Region zu
entwickeln, um die darin liegenden Möglichkeiten zu nutzen, und
zugleich Vorkehrungen zu treffen für den Fall, daß die
Eigenständigkeit der Gemeinde bedroht wäre. Dazu mußte die Gemeinde
wirtschaftlich stark werden und den Willen haben, ihre Eigenständigkeit
zu behaupten. Die Entwicklung der 60er und 70er Jahre war dann auch so:
Es gab eine starke Tendenz, größere Verbände zu schaffen und die
Gemeinde größeren Einheiten unterzuordnen; und Frickenhausen war stark
genug, sich seine Selbständigkeit zu bewahren.
Die erste und wesentliche Phase des Wiederaufbaus, die Beseitigung
der Kriegsfolgen und die Schaffung einer neuen Grundlage für das
Gemeinwesen, war um die Mitte der 60er Jahre abgeschlossen. Eine fast 20
Jahre dauernde Periode intensiver Arbeit ging damit zu Ende. Die
Gesellschaft, auch die Gemeinde Frickenhausen, änderte ihr Gesicht. In
der Gemeinde waren wesentliche Verbesserungen erreicht, vieles gebaut
oder doch auf den Weg gebracht worden. Trotz aller Ausgaben hatte die
Gemeinde einen soliden und ausgeglichenen Haushalt und niemals
finanzielle Sorgen. Der Grund dafür war der, daß sich zum einen die
Industrieansiedlung positiv auszuwirken begann, unser Vater zum andern
alle Vorhaben sehr langfristig betrieb und zur Vorbereitung nicht nur
die Suche nach der günstigsten Möglichkeit, sondern auch das
frühzeitige Bilden von Rücklagen gehörte. Das Schuldenmachen war ihm
immer ein Greuel, übrigens auch im privaten Bereich. Denn auch die
Schulden, sofern sie nicht wirklich getragen werden können, bedrohten
nach seiner Einsicht die Freiheit und die Eigenständigkeit der
Gemeinde, indem sie abhängig machen. (Man darf bei dieser Haltung an
die heutigen Verhältnisse im Staat gar nicht denken.) Daß der
Bürgermeister im Hinblick auf die Finanzen nur der getreue Haushalter
der Gemeinde sein könne, war ihm immer selbstverständlich. Ebenso die
Einsicht, daß man sich nur das leisten könne, was man finanziell auch
tragen kann. Er fürchtete bei den Schulden nicht so sehr den Druck der
Zinsen, sondern die Gefahr, der Blick für die Realität könnte
getrübt werden oder verloren gehen. Manche Auseinandersetzungen in der
Gemeinde während der späten 60er und der 70er Jahre gehen darauf
zurück, daß er sich Wünschen verweigerte, die nur über Schulden zu
finanzieren waren, den Blick auf die Realität der Gemeinde also
verstellten. Natürlich hat die Gemeinde manches über Kredite
finanziert; aber die Rückzahlung mußte überschaubar und gesichert
sein. Ihm ging es nicht darum, möglichst schnell möglichst Alles zu
haben, sondern den Aufbau solide und reell zu vollziehen und die eigenen
Möglichkeiten realistisch im Blick zu behalten. Er konnte fast wütend
werden, wenn er das Gefühl hatte, man mute ihm zu, die Grundlage dieser
Seriosität zu verlassen. Zum Ausdruck kam darin auch sein Verhältnis
zum Geld. Er hat tüchtige Leute immer geschätzt und gerne mit ihnen
zusammengearbeitet. Und er fand es auch völlig in Ordnung, daß
Tüchtigkeit sich in einem entsprechenden Verdienst niederschlug. Aber
Leute, die bloß Geld hatten, haben ihn nie beeindruckt. Seine
Lebenserfahrung war groß genug, um zu wissen, auf welchem Wege
Vermögen zustande kommen können. Und er hat vor allem immer versucht,
dem Einzelnen, ganz unabhängig davon, ob er wohlhabend war oder nicht,
in seinem Anliegen gerecht zu werden. Er sah sich als Bürgermeister
allen Bürgern verpflichtet, welcher Besitzklasse der Einzelne
angehörte, spielte dabei keine Rolle. Oft waren es gerade die, die
wenig hatten, für die er sich besonders eingesetzt hat.
Dahinter stand die Vorstellung vom Gleichgewicht. Wie verschieden
sich die Situation der Einzelnen in finanzieller Hinsicht auch
darstellte, sie hatten alle ihren Platz im Gemeinwesen, gehörten zum
Dorf und durften darin nicht geschmälert werden. Das Gleichgewicht
entstand durch den gemeinsamen Bezug aufs Dorf, und unser Vater sah
seine Aufgabe als Bürgermeister darin, dieses Gleichgewicht zu
erhalten, oder dort, wo es gefährdet war, einzugreifen. Diese Haltung
hat ihm viel Respekt eingetragen und dazu geführt, daß er öfter in
Familienangelegenheiten um Rat gefragt wurde. Auch auf einem anderen
Gebiet, dem der Industrieansiedlung, hat er versucht, ein Gleichgewicht
zu finden. Sein Ziel war es, zum einen den Menschen aus dem Dorf eine
Chance zum Aufbau eines Betriebes zu geben (soweit das von der
Gemeindeverwaltung abhing), zum andern möglichst Betriebe aus
verschiedenen Branchen anzusiedeln, um die Gemeinde nicht, wie es bei
der Schuh- und Textilindustrie der Fall gewesen war, durch die Krise
einer Branche zu gefährden, und möglichst vielfältige Arbeitsplätze
zu schaffen. Und es ging ihm auch darum, die Gemeinde nicht von einem
Großbetrieb abhängig werden zu lassen. Er sagte einmal, daß er,
selbst wenn er einen goldenen Schreibtisch bekäme, nicht Bürgermeister
von Sindelfingen sein wolle. Das Gleichgewicht unter den Betrieben und
Branchen war für ihn notwendig, damit die anderen, nicht-ökonomischen
Bereiche der Gemeinde sich ungestört entfalten konnten.
Seit dem Ende der 60er Jahre trat die Diskussion über die
Gemeindereform in ihre entscheidende Phase. Damit war auch die
Selbständigkeit der Gemeinde Frickenhausen in Frage gestellt. Nach der
Planung der Zentrale in Stuttgart sollte Frickenhausen zur Stadt
Nürtingen geschlagen werden. Größere Verbände seien per se
effektiver als kleinere selbständige Einheiten, so lautete die damalige
Überzeugung, die dann auch umgesetzt wurde. Von seiner Grundhaltung
her, der selbstverantworteten Freiheit, mußte dieser Ansatz unseren
Vater mißtrauisch machen. Er mißtraute den großen Einheiten mit ihren
dogmatischen Verfahren und Schablonen, die seiner Überzeugung nach der
Vielfalt der wirklichen Verhältnisse und des Lebens nicht gerecht
werden konnten. Zur Arbeit an der auf einem soliden Fundament
gegründeten Entwicklung der Gemeinde kam nun die Aufgabe, ihre
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu bewahren. Das war nach
Lage der Dinge nur möglich, wenn sich Frickenhausen mit den
benachbarten Gemeinden Tischardt und Linsenhofen zusammenschloß, damit
die drei beteiligten Gemeinden gemeinsam der Eingemeindung entgingen. In
Tischardt war unser Vater seit 1954 Bürgermeister; er hatte sich zur
Wahl dort beworben, weil er eine Zusammenarbeit der Gemeinden
Frickenhausen und Tischardt für sinnvoll und notwendig erachtete. Zur
Gemeinde Linsenhofen hatte er sich immer um ein gutes Verhältnis
bemüht, auch schon früh versucht, die Vorbehalte, die in Frickenhausen
und Linsenhofen gegeneinander bestanden, auszuräumen. Die strategische
Entscheidung, auf einen Zusammenschluß der Gemeinden Frickenhausen,
Tischardt und Linsenhofen hinzuarbeiten, war für ihn die Möglichkeit,
unter den gegebenen Umständen die größtmögliche Selbständigkeit
aller drei Gemeinden zu bewahren. Er hat deshalb auch versucht, die
Eingemeindungsverträge möglichst fair und gerecht zu gestalten, um zu
einem Gleichgewicht zwischen den Interessen der Gemeinden zu gelangen.
Nach seiner Vorstellung wäre es das Beste gewesen, die drei Gemeinden
hätten weiter jede für sich bestanden und wären selbständig
geblieben. Aber er war realistisch genug einzusehen, daß die
Alternative zum Zusammenschluß der drei Gemeinden die Eingemeindung in
ein Oberzentrum, Nürtingen oder Neuffen gewesen wäre. Man hat seinen
Widerstand gegen die Pläne des Ministeriums zu brechen versucht, indem
man ihm verschiedene lukrative Angebote machte; er hat sie alle
abgelehnt.
Seine Skepsis gegenüber der sogenannten Gemeindereform sah er in
späteren Jahren bestätigt. Zehn Jahre nach ihrer Einführung hat er
ausgiebig darüber gespöttelt, wie sehr es ihn wundere, daß niemand
auf die Idee gekommen sei, zum 10-jährigen Jubiläum der Gemeindereform
eine Festveranstaltung durchzuführen. Die Schaffung größerer
Einheiten hatte die Verwaltung nicht effektiver gemacht, sondern zu mehr
Aufwand und zu größerer Entfernung von den Bürgerinnen und Bürgern
geführt.
Manchmal hat er das Jahr 1970 als ,,Schicksalsjahr” bezeichnet.
Persönlich gesehen hing dies mit einer schweren Krankheit zusammen,
einer Operation, deren Risiko so groß war, daß die Ärzte ihm
empfahlen, für alle Fälle sein Testament zu machen. Zum ersten Mal
seit dem Krieg stieß er wieder an die Grenze des Todes. Aber es war
nicht nur das persönliche Schicksal, das er tragen mußte, was ihm das
Jahr 1970 bedeutungsschwer machte. Es stellte sich sehr deutlich heraus,
daß die Zeit sich gegenüber der Aufbauphase nach dem Krieg
tiefgreifend verändert hatte. Er spürte dies im Wechsel der Stimmungen
in der Gemeinde, dem einsetzenden Wertewandel und auch in den
persönlichen Angriffen gegen sich selbst, die er als unsachlich,
beleidigend und verletzend empfand. Es entstanden neue Fragestellungen,
und manche von denen, die er als Freunde geschätzt hatte, standen ihm
plötzlich als Gegner gegenüber. Ein Jahrzehnt später hat er sein
Nachdenken über diese Entwicklung in die Frage gekleidet, ,,ob wir
nicht beim Wiederaufbau nach dem Krieg etwas Wesentliches vergessen
haben”, und er meinte damit die Verpflichtung auf das Gemeinwesen, auf
die Gemeinde, die er als Korrektur des bloßen Privatinteresses für
unbedingt notwendig hielt. Die Zweifel an einer Wohlstandsgesellschaft,
der die inneren Verbindungen und Verbindlichkeiten verloren gehen,
verdichteten sich für ihn immer mehr und wurden in den späten 80er
Jahren zur Gewißheit, daß das Gemeinwesen eigentlich kein Fundament
mehr hatte. Er sah, wie das Gemeinwesen in Gruppeninteressen und
Einzelegoismen zerfiel und das Gleichgewicht zwischen dem Bezug aufs
Gemeinwesen, der Verpflichtung gegenüber der Gemeinde und dem Land, und
den berechtigten Interessen des Einzelnen zunehmend verloren ging. Und
er fand Beispiele dafür auf allen Ebenen, von der der Gemeinde bis zu
der des Bundes. In seinen letzten Jahren stand er der Entwicklung sehr
skeptisch gegenüber.
In der Rede, die er bei seiner Verabschiedung nach 38 Dienstjahren
als Bürgermeister von Frickenhausen, Tischardt und Linsenhofen hielt,
griff er noch einmal auf jene Rede zurück, die er bei seiner ersten
Kandidatur zum Bürgermeisteramt 1948 gehalten hatte. Wichtig war ihm
nicht, mit großer Geste auf die Erfolge seiner Amtszeit hinzuweisen –
und er hätte dabei doch vieles aufzählen können –, sondern
öffentlich redend darüber nachzudenken, ob die Überzeugungen und
inneren Leitlinien, die er damals aufgestellt hatte, haltbar gewesen
waren, und ob er sie erfüllt hatte. Das Dorf und die Gesellschaft
insgesamt waren ohne Zweifel besser ausgestattet, wohlhabender, reicher
geworden. Aber er fragte nach den moralischen Prinzipien, den
Überzeugungen, die ihn damals, als die Not groß und ihre Überwindung
kaum absehbar war, geleitet hatten. Schon einige Jahre zuvor, als ihm
das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, hatte er in seiner Dankesrede
höflich darauf hingewiesen, daß es ihm um etwas anderes gehe als die
äußere Ehre eines Ordens. Man könne eigentlich niemanden ehren, der
nur das getan, was seine Pflicht gewesen und der seinen Überzeugungen
treu geblieben sei. In seiner Abschiedsrede 1986 schloß er den Kreis,
schlug den Bogen zurück zum Anfang und bekräftigte noch einmal die
Überzeugungen, mit denen er begonnen hatte.
Autoren- und Herausgeberteam, 1994
Zurück zum Seitenanfang
|